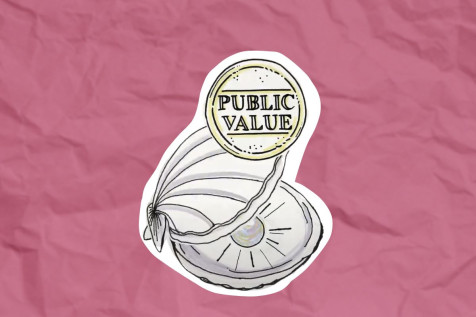Mehr als Pomp und Pop? Was der ESC der Gesellschaft bringt
2025 gastiert der Eurovision Song Contest in der Schweiz. Er kostet zwar Millionen, generiert laut Expert:innen aber auch gesellschaftlichen Mehrwert: Der ESC trägt zu Wertschöpfung, kulturellem Austausch und Vielfalt bei. Fraglich ist allerdings, ob er auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert.
Für die einen ist er das Highlight des Jahres, für die anderen eine unnötige Veranstaltung mit viel Pomp und schlechter Musik. Die Meinungen zum Eurovision Song Contest (ESC) gehen weit auseinander. Fakt ist: Der ESC ist der grösste Musikwettbewerb der Welt, den weltweit jeweils zwischen 150 und 200 Millionen Menschen verfolgen. Fakt ist auch: Die Mega-Veranstaltung kommt 2025 in die Schweiz und die SRG darf den ESC durchführen – oder muss, je nach Perspektive. So betonten kritische Stimmen schon kurz nach Nemos Sieg in Schweden die hohen Kosten, die der Anlass mit sich bringt. Doch hat der ESC auch positive Effekte, schafft er einen gesellschaftlichen Mehrwert? Und wenn ja, welchen?
Land als Reiseziel vermarkten
Genau dieser Frage widmete sich auch das diesjährige Public Value Fest in Lissabon. An der mehrtägigen Veranstaltung diskutierten Vertreter:innen aus Forschung, Lehre und Praxis zum Thema Public Value aus einer gesamteuropäischen Perspektive.

Was bringt der ESC? Diese Frage diskutierten ESC-Experte Irving Wolther, Emilie Demaurex (SRG) und Maria Ferreira vom portugiesischen Fernsehen unter der Leitung von Timo Meinhardt (v.l.n.r.) an einem Panel am Public Value Fest in Lissabon.
Bild: Freguesia de Estrela
An der Paneldiskussion zum ESC nahm unter anderen Maria Ferreira teil. Die Vize-Direktorin der Abteilung Musik und Kunst beim portugiesischen Medienhaus RTP gehörte zum Produktionsteam, das 2018 den ESC in Lissabon auf die Beine stellte. Sie weiss deshalb aus erster Hand, was der ESC für das Gastgeberland bedeuten kann – und was die Schweiz vom Grossevent erwarten darf.
So hob Maria Ferreira etwa den wirtschaftlichen Mehrwert und das touristische Potenzial des ESC hervor. «Eines unserer strategischen Ziele war, Werbung für die Stadt und das ganze Land zu machen», sagte sie. Dazu habe man eng mit der staatlichen Tourismusagentur zusammengearbeitet und beispielsweise für jeden teilnehmenden Song ein Video aus einer anderen Ecke des Landes produziert. «Damit konnten wir einem grossen Publikum Portugal als Reiseziel schmackhaft machen.»

Maria Ferreira, Vize-Direktorin der Abteilung Musik und Kunst beim portugiesischen Medienhaus RTP, gehörte zum Organisationsteam des ESC 2018 in Lissabon.
Bild: Freguesia de Estrela
Lissabon habe sich ausserdem als Austragungsort für grosse, internationale Events positionieren können. Und nicht zuletzt hat der ESC laut Maria Ferreira vorübergehend zahlreiche Jobs geschaffen. «Über 1500 Personen waren in die Planung und Durchführung des Events involviert.»
Dank Sponsoring und Partnerschaften konnte RTP die finanzielle Belastung gering halten – letztlich schaute für das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen gar ein Überschuss von rund vier Millionen Euro heraus.
Den wirtschaftlichen Schub, den der ESC dem Austragungsort verleihen kann, wies auch eine Studie zur letztjährigen Durchführung in Liverpool nach. Gemäss der Evaluation generierte der Anlass für Hotels, Restaurants, Läden und weitere Betriebe in der englischen Stadt zusätzliche Einnahmen von rund 55 Millionen Pfund. Daneben zeigte die Studie auch eine grosse Beteiligung und ein starkes Engagement der lokalen Bevölkerung, von Künstler:innen und Organisationen auf, beispielsweise in Form von Freiwilligenarbeit oder der Teilnahme an den zahlreichen kulturellen Events und Community-Programmen rund um den ESC.
Verkauf von TV-Geräten ankurbeln
Schon seit der ersten Austragung war der ESC mehr als nur eine Pomp- und Popveranstaltung. Von Anfang an lieferte der Wettbewerb nebst wirtschaftlicher Wertschöpfung auch einen Mehrwert für die Gesellschaft mit, wie am Panel in Lissabon ebenfalls ausgeführt wurde. «Der Anlass brachte nach dem Zweiten Weltkrieg die europäischen Länder zusammen, förderte die Toleranz und die europäische Integration», erläuterte der deutsche Sprach- und Kulturwissenschaftler Irving Wolther. Dabei sei der Musikwettbewerb von der European Broadcast Union (EBU) in den 1950er-Jahren mit einer ganz anderen Absicht ins Leben gerufen worden.
«Mit dem Wettbewerb sollte der Verkauf von Fernsehgeräten angekurbelt werden», so Wolther, der auch als Dr. Eurovision bekannt ist, weil er zum ESC promoviert hat. weil er zum ESC promoviert hat. Auch heute wolle die EBU nicht primär gesellschaftlichen Mehrwert bieten, sondern eine Live-Fernsehproduktion von Weltklasse.
Der ESC als Austauschprogramm
Für Dr. Eurovision heisst diese kommerzielle Ausrichtung aber nicht, dass der Musikwettbewerb implizit nicht auch einen gesellschaftlichen Beitrag leistet und etwa den Zusammenhalt und den kulturellen Austausch fördert. «Ich sehe den ESC als Kurz-Austauschprogramm, bei dem man einiges über andere Länder, deren Kultur und Sprache erfährt.»

Hat zum Eurovision Song Contest promoviert und wird daher Dr. ESC genannt: Der deutsche Sprach- und Kulturwissenschaftler Irving Wolther.
Bild: Freguesia de Estrela
Allerdings, so Wolther, riskiere der Anlass derzeit, zu einer Nischenveranstaltung zu werden. «Wird die Diversität der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität zu stark in den Vordergrund gerückt, fühlen sich grosse Teile der Bevölkerung wohl nicht mehr vertreten.» Die EBU müsse darauf achten, dass der ESC nicht zu einer «Queer Music Show» werde, der vor allem die LGBTQ+-Gemeinschaft anspreche. Wie stark der ESC grundsätzlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert, ist demnach fraglich. Klar ist hingegen, dass der Musikwettbewerb in anderen Bereichen durchaus einen Mehrwert für die Bevölkerung schaffen kann.
Mehrwert für die Bevölkerung maximieren
In der Schweiz soll der gesellschaftliche Mehrwert möglichst gross ausfallen, wie Emilie Demaurex sagte, die für die SRG am Panel in Lissabon teilnahm. «Unser Anspruch ist es, gesellschaftliche Minderheiten sichtbar zu machen und ihnen Gehör zu verschaffen. Und wir wollen möglichst viele Schweizer:innen ansprechen und zusammenbringen», so die Projektleiterin und Verantwortliche für den Dialog mit der Gesellschaft im Bereich Public Value. Der ESC solle den Zusammenhalt im Land fördern, eine gemeinsame kulturelle Erfahrung ermöglichen und die verschiedensten Lebensrealitäten in der Schweiz aufzeigen. Damit dies gelingt, werde der potenzielle gesellschaftliche Mehrwert des Events von Anfang an mitgedacht, sagte Demaurex. «Von der Planung und dem Marketing über die Durchführung bis zur Evaluation des ESC: Diversität, Zusammenhalt und Wertschöpfung werden in jedem Schritt berücksichtigt.»

«Unser Anspruch ist es, gesellschaftliche Minderheiten sichtbar zu machen und ihnen Gehör zu verschaffen. Und wir wollen möglichst viele
Schweizer:innen ansprechen und zusammenbringen» Emilie Demaurex, Projektleiterin Public Value bei der SRG.$
Bild: Freguesia da Estrela
Tobias Hänni, Juli 2024